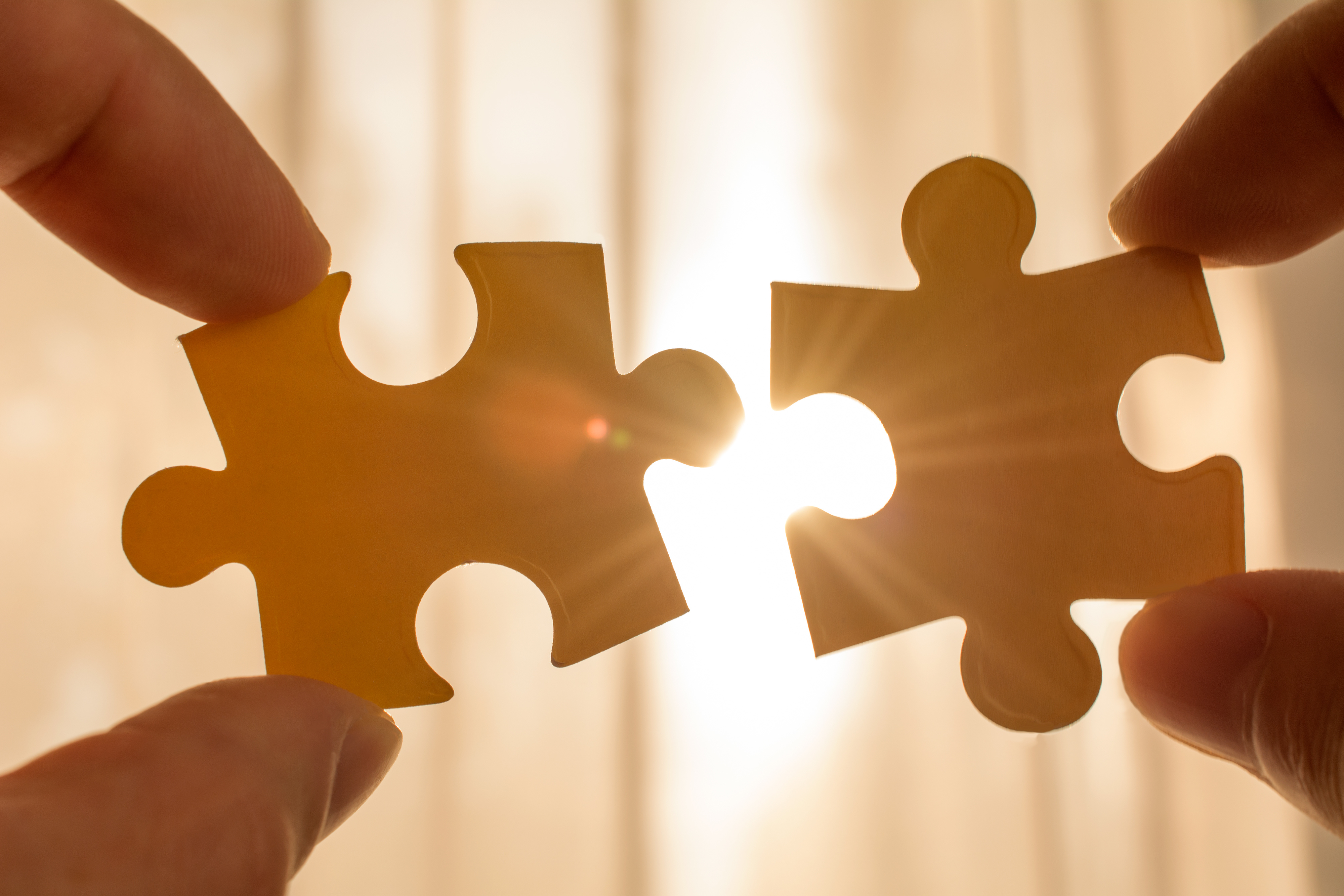Welche zentrale Rolle spielt Eurotransplant eigentlich und wie regelt die Organisation die Zuteilung von Organen in Europa? Informieren Sie sich hier.
LESEN SIE HIER WEITERAllokation der Organspende: Was bedeutet das?
Der Begriff Allokation im Kontext der Organspende beschreibt die strukturierte Verteilung von Spenderorganen an geeignete Empfängerinnen und Empfänger nach klaren gesetzlichen Vorgaben und medizinischen Kriterien. Zuständig für diesen Prozess ist in Deutschland die Stiftung Eurotransplant, die auch für sieben weitere europäische Länder zuständig ist. Zusammen bilden diese acht Länder den ET-Verbund innerhalb derer Organe, auch grenzüberschreitend, vermittelt werden. Etwa 14.000 Menschen stehen derzeit auf den Wartelisten des gesamten ET-Verbunds. Die Allokation erfolgt neutral und objektiv, um maximale Fairness und medizinischen Erfolg zu gewährleisten. Vier allgemeine Kriterien sind bei der Vermittlung von Bedeutung:
- Dringlichkeit der Transplantation
- Aussicht auf langfristigen Therapieerfolg
- Wartezeit der Empfängerinnen und Empfänger
- Organtauschbilanz zwischen den Ländern des ET-Verbunds
Die Entscheidung, wer ein Organ erhält, liegt also nicht bei den Spenderinnen und Spendern oder deren Angehörigen, sondern bei einem geregelten, solidarischen System.