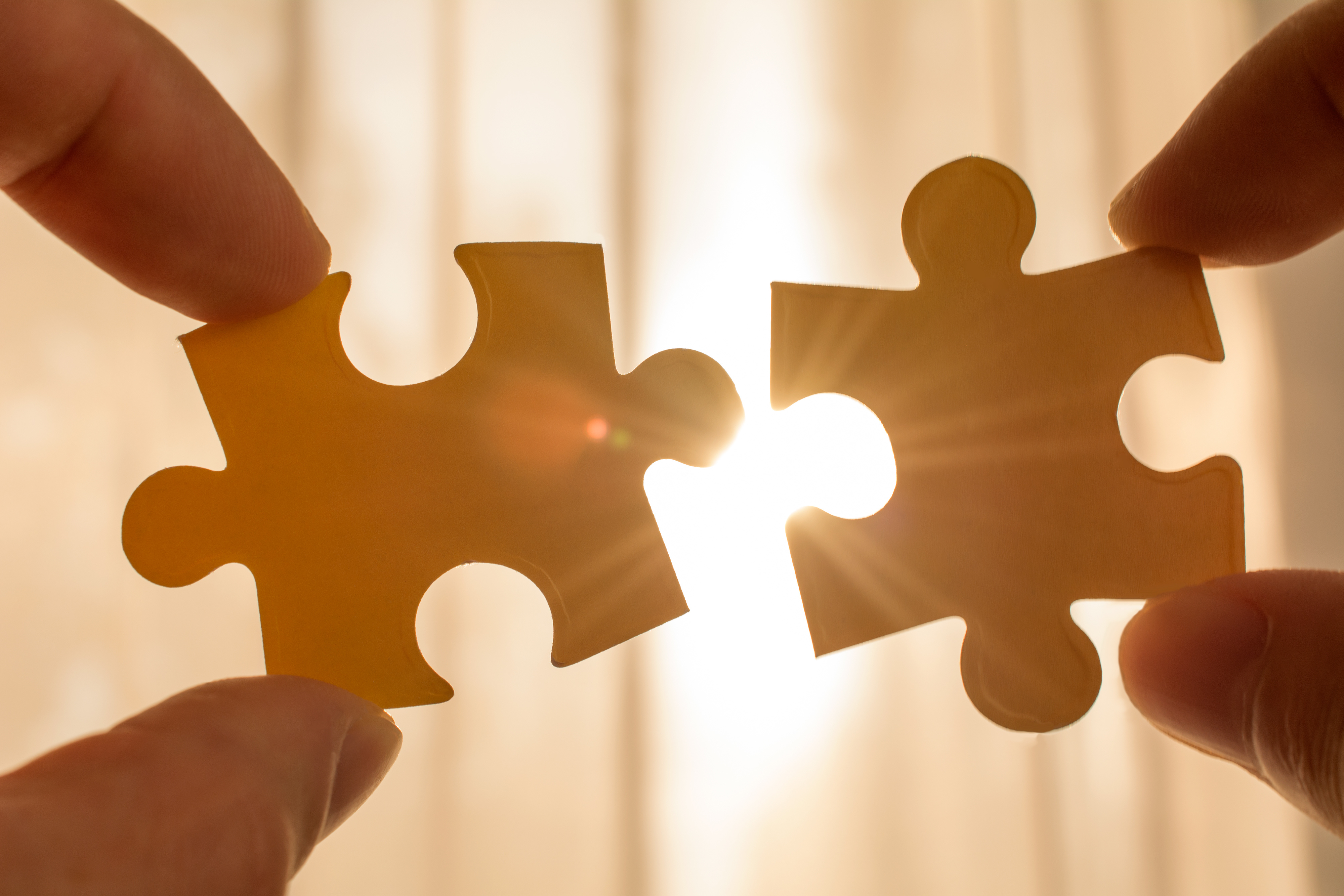Was steckt eigentlich hinter der Widerspruchslösung und wieso wird so viel über sie diskutiert? Lesen Sie hier mehr darüber.
LESEN SIE HIER WEITEROrganspende und demokratische Verantwortung
Organspende ist nicht nur eine medizinische Entscheidung, sondern auch ein Ausdruck demokratischer Werte einer Gesellschaft. Um den Grundsätzen der Demokratie zu entsprechen, muss das Recht über den eigenen Körper zu bestimmen, gewahrt werden. Niemand darf gezwungen werden, die eigenen Organe zu spenden. In einer demokratischen Gesellschaft wie Deutschland würde ein solcher Zwang in die Grundrechte massiv eingreifen.
Eine demokratische und freie Gesellschaft hat mit den heutigen medizinischen Möglichkeiten der Organspende zwei Aufgaben: Sie muss zum einen den Menschen helfen, die verzweifelt auf ein Spenderorgan warten. Aber sie muss gleichzeitig auch das Recht auf Selbstbestimmung jeder Person wahren, die potenziell Organe spenden könnte. Genau diese Herausforderung, beidem gerecht zu werden, sorgt immer wieder für Diskussionen.